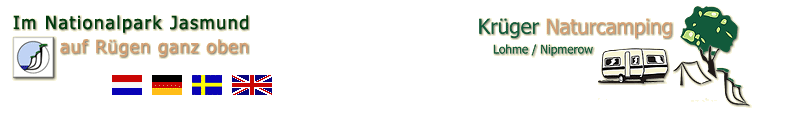| Der Campingplatz | Campingoase Polchow | Wohnwagen | Fotogalerie | Gästebuch | Anfrage | Impressum | AGB |
| Aktuelles | Angebote | Freizeit & Sport | Anreise | Links | Umgebung | Sehenswürdigkeiten | Wetter | Preise | Datenschutzerklärung |
Was ist ein Nationalpark? Ein Nationalpark ist ein Schutzgebiet, in dem sich die Natur weitgehend ungestört und möglichst ursprünglich entfalten kann. Er soll ein großflächiges Gebiet mit besonders wertvoller Naturausstattung umfassen, das durch den Menschen wenig beeinflusst und nicht mehr Ziel einer wirtschaftlichen Nutzung ist. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, soll es der Allgemeinheit Erholung, Entspannung und naturkundliche Bildung ermöglichen. Diese Ansprüche erfüllen in Mitteleuropa nur noch wenige Regionen. Geologie Die aktiven Steilufer des Nationalparkes Jasmund stellen den größten geologischen Aufschluss Norddeutschlands dar. Auf Grund der sturmexponierten Lage Jasmunds sind die Steilufer bis in die Gegenwart aktiv, d.h. es finden immer wieder Abtragungsprozesse statt, die die Küstenlinie allmählich ins Hinterland verlagern, und verhindern, dass sich eine Pflanzendecke ausbreiten kann. So sind hier ständig Gesteinsschichten "aufgeschlossen", die anderen Orts nicht oder nur punktuell und zeitlich begrenzt zugänglich sind. Bei einer Strandwanderung trifft man nicht nur auf die weiße Kreide mit Schichten schwarzer Feuersteinknollen. Auch Geschiebemergel, die von eiszeitlichen Gletschern abgelagert worden sind sowie sandige Ablagerungen von Schmelzwässern bauen den Untergrund auf. Mit den eiszeitlichen Geschieben finden sich Dokumente für viele Epochen der erdgeschichtlichen Vergangenheit des skandinavisch-baltischen Raumes. |
Klima und Böden Das Gebiet liegt durchschnittlich etwa 100 m über dem Meeresspiegel und ragt mit dem Pickberg bis auf 161 m empor. Es besitzt ein - aufgrund der Höhe und exponierten Lage in der Ostsee - ganz besonderes, dem Charakter nach teils maritimes, teils montan-winterkaltes Klima. Mit ca. 800 mm Niederschlag im Jahr ist Ostjasmund das niederschlagsreichste Gebiet an der deutschen Ostseeküste. Böden entstehen in der Zone, in der sich Lithosphäre, Hydrosphäre, Atmosphäre und Biosphäre überlagern und durchdringen. Auf Jasmund sind ganz unterschiedliche Böden entwickelt. Kreide, Geschiebemergel, Sande und organische Bildungen wie Torf sind die Ausgangsmaterialien für die Bodenbildung. Weiterhin führen Unterschiede im Relief und in der Feuchtigkeit zu verschiedenartigen Bodenbildungen. |
Wasserhaushalt und Gewässer Der Erhalt des immer noch sehr naturnahen Wasserhaushalts ist ein wesentliches Schutzziel im Nationalpark. Ostjasmund ist das niederschlagsreichste Gebiet an der deutschen Ostseeküste mit ca. 800 mm pro Jahr. Das im Untergrund versickerte Wasser tritt in Quellen wieder zu Tage und fließt über Bäche, die wegen ihres starken Gefälles an Gebirgsbäche erinnern, zum Strand und münden dort in die See. Auch ein etwa 500 m breiter Streifen der Ostsee gehört zum Nationalparkgebiet. Im Nationalpark gibt es nur wenige Seen und Weiher, die meisten sind bereits verlandet. So finden sich dann auch mehr als einhundert Moore im Gebiet. Innerhalb des Wasserhaushaltes kommen ihnen wichtige Speicherfunktionen zu. Leider sind heute nicht mehr alle Moore in einem naturnahen Zustand. Alte Entwässerungsgräben zeugen von früheren Versuchen, diese Feuchtgebiete trocken zu legen und zu nutzen. Gegenwärtig läuft im Nationalpark ein Programm zur Moorrevitalisierung. |
Geschichte Um die Landschaft ganzheitlich zu verstehen, muss man ihre Geschichte kennen. Im Nationalpark Jasmund finden sich Zeugnisse verschiedener Epochen der Erd- und Menschheitsgeschichte. Das Spektrum reicht von Milliarden Jahren alten Gesteinen, die von eiszeitlichen Gletschern aus Skandinavien verschoben wurden, über die 70 Millionen Jahre alte Rügener Schreibkreide mit ihren Fossilien und Feuersteinen, die Bodendenkmäler aus frühgeschichtlicher Zeit bis zu einem aus Amerika stammenden Mammutbaum, der vor Ausweisung des Nationalparkes von einem Förstern gepflanzt wurde. Landgeschichte Das Gebiet des Nationalparkes Jasmund wurde während der letzten Eiszeit von Inlandgletschern überprägt. Sie stauchten die im Untergrund anstehende Kreide und ältere eiszeitzliche Schichten zu einem Höhenrücken auf. Er ragt heute 161 m über die Ostsee und besitzt ein stark gegliedertes Relief. Vor etwa 14.000 Jahren endete die Vergletscherung im Gebiet Rügens. Nachfolgend breiteten sich zunächst eine Kältesteppe, später Birken- und Kiefernwälder, dann Eichenmischwälder aus. Während der letzten 2.000 Jahre herrschten Buchenwälder im Gebiet vor. In abflusslosen Senken entstanden Seen, die verlandeten und zu Mooren wurden. Vor etwa 6.000 Jahren stieg der Meeresspiegel auf sein heutiges Niveau an. Hochgebiete wie Jasmund wurden zu Inseln. Durch die abtragende Wirkung von Wellen und Strömungen entstanden Steilufer, die bis heute das Landschaftsbild prägen. Ur- und Frühgeschichte Das Gebiet der heutigen Halbinsel Jasmund ist seit der mittleren Steinzeit bewohnt. Bodenfunde und Bodendenkmäler wie auch pollenanalytische Befunde machen es möglich, die Siedlungsgeschichte zu rekonstruieren. Vor etwa 5.500 Jahren hinterließen Jäger und Sammler der sogenannten Lietzow-Kultur vor allem Abschläge aus Feuerstein. Sie fielen bei der Herstellung von Waffen und Werkzeugen an. Die ältesten jungsteinzeitlichen Bauernkulturen sind etwa 5.000 Jahre alt. Erstmals lichtete der Menschen in dieser Zeit die, bis dahin geschlossene Waldlandschaft auf. Bodendenkmäler dieser Epoche sind die Großsteingräber. Aus der vor etwa 3.800 Jahren beginnenden Bronzezeit stammen Burgwälle und Hügelgräber. Die kontinuierliche Besiedlung Jasmunds lässt sich durch die Eisenzeit bis zum Beginn Völkerwanderung belegen. Vor etwa 1.700 Jahren verlässt der bis dahin auf Rügen ansässige germanische Stamm der Rugier die Insel. Erneut breitet sich der Wald aus. Seither hat es auf Ostjasmund keine wesentlichen Rodungen mehr gegeben. |
Lebensräume Der Nationalpark Jasmund gehört zu den wenigen Landschaften Deutschlands, in denen die Abfolge vom geschlossenen Wald zu natürlich offenen Biotopen zu beobachten ist. Im Gebiet blieb ein reiches Spektrum naturnaher Ökosysteme bis in die Gegenwart erhalten, das durch weitgehende Eigendynamik gekennzeichnet ist. Dazu gehören die Flachwasserzonen der Ostsee, Blockstrände, Steilküsten, Wälder sowie Bäche und Moore. Überall laufen die natürlichen Prozesse ohne menschliche Eingriffe ab. Alles ist in steter Veränderung, nur die Geschwindigkeit der Veränderungen ist verschieden. Die meisten Ökosysteme können als sich zyklisch wandelnde Mosaikgefüge aufgefasst werden. Sie bestehen aus ineinandergreifenden Übergängen unterschiedlicher Entwicklungsstadien. Wälder Die Landfläche des Nationalparkes wird von Buchenwäldern dominiert, die über 80 % der Waldfläche einnehmen. Im Frühjahr, bevor das Laub austreibt, zeigt sich die Vielfalt der Buchenwälder. Es ist die Zeit der Frühblüher und der Waldboden ist blühtenübersät. Aber man trifft auf Unterschiede und Differenzierungen. Je nach dem, auf welchem Untergrund der Buchenwald wächst, auf Kreide-, Mergel-, Lehm- oder Sandboden, finden sich ganz unterschiedliche Pflanzen in der Krautschicht des Waldes. Die Blütenpracht ist jedoch von kurzer Dauer. Sobald sich das sommerliche Laubdach geschlossen hat, ist es zu dunkel für viele Kräuter und Gehölze. Deshalb fehlt den Buchenwäldern auch eine Strauchschicht. Die restlichen 20 % der Waldfläche werden je zur Hälfte von anderen Laubbaumarten wie Erle und Esche (vorrangig in feuchten Senken) und von Nadelbaumarten wie Fichte und Lärche geprägt. Steilufer Die Steilküste Jasmunds ist eine besonders exponierte Außenküste und zugleich die höchste im südlichen Baltikum. Bei nordöstlichem Sturm entwickeln sich auf der freien Wasserfläche der Ostsee Wellen mit gewaltiger Kraft. Die Brecher erreichen das Kliff und schwemmen das aus dem Kliff gebrochene Material vom Strand ins Meer. So bleibt die Steilheit der Kliffs erhalten. Immer wieder kann Gestein nachbrechen und abrutschen. Besonders im Winter, wenn der Spaltenfrost wirkt, und in feuchten Jahren ist es nicht ungefährlich, unterhalb der Steilufer zu laufen. Andere Abschnitte des Steilufers sind bereits zur Ruhe gekommen. Zunächst besiedeln Gräser und Kräuter Abbruchflächen und Hangschutt. Im Laufe von Jahrzehnten verbuschen die Flächen und entwickeln sich schließlich zu artenreichen Naturwäldern. Wo grundwasserführende Schichten angeschnitten sind, treten Quellen aus. Das Wasser fließt in Rinnsalen zum Strand hinunter oder speist kleine Quellmoore. Blockstrände Blockstrände säumen die Steilufer des Nationalparkes. Sie sind die Grenze zwischen Land und Meer. Blockstrände von Badelustigen gemieden, bieten Naturfreunden viel Interessantes: Feuersteine und Versteinerungen aus der Kreide, skurrile Skelette abgestürzter Bäume sowie eiszeiliche Geschiebe in allen Farben, Formen und Größen. Es handelt sich um Steine, die einmal in Skandinavien oder dem Baltikum beheimatet waren und zu ganz unterschiedlichen Gesteinsarten gehören. Im Spülsaum findet man, was die Wellen ans Ufer geworfen haben, verschiedene Algen, Muschel- und Schneckenschalen und mit etwas Glück sogar Bernstein. Hin und wieder trifft man zwischen den Steinen auch auf die wenigen salzertragenden Pflanzen wie den Meerkohl, den Meerstranddreizack oder das Salz-Milchkraut. Sie gedeihen auf dem kargem Boden zwischen den Blöcken und widerstehen der Überflutung durch das brackige Ostseewasser ebenso wie dem Licht und der Hitze in der prallen Sommersonne. Quellen und Bäche Naturbelassene Quellen und Bäche gibt es in Mitteleuropa faktisch kaum noch. Quellen wurden Wasserfassungen und Bäche zu begradigten Entwässerungsgräben. Damit verschwanden nicht nur einzigartige Lebensräume, sondern auch Orte, die im Volksglauben der Vergangenheit als Heiligtümer verehrt wurden. Doch auf Jasmund gibt es sie noch, zahlreiche Quellen, die sich in Schüttungsmenge und Wasserqualität unterscheiden. So finden sich Quellen kalkreichen Wassers, in denen es zur Ablagerung von Quellkalken kommt. Es gibt Quellen, die eisenreiches Wasser führen und solche, die sich durch erhöhte Schwefelwasserstoff- und Kohlendioxid-Gehalte auszeichnen. Im Gebiet gibt es zahlreiche Fließgewässer. Die größeren Bäche entspringen in Quellmooren des Hochbereiches und fließen frei mäandrierend durch den Buchenwald zum Steilufer. Dort strömt das Wasser mit hoher Geschwindigkeit und stürzt zum Teil über kleine - für Mecklenburg-Vorpommern jedoch gewaltige - Wasserfälle die Hänge hinab zum Strand. Ostsee die Geheimnisse des Brackwassers... Zum Nationalpark gehört auch der unmittelbar dem Strand vorgelagerte, 500 m breite Flachwasserbereich der Ostsee. Das Nationalparkgebiet endet bei etwa 10 m Wassertiefe. Der Meeresboden ist mit unterseeischen Kreiderücken, algenbewachsenen Geröllfeldern, Muschel- und Sandbänken sowie Schlickgründen in unterschiedliche Lebensräume differenziert. Aber die Halbinsel Jasmund liegt sehr sturmexponiert in der Ostsee und in strengen Wintern wird Packeis zu mächtigen Barrieren zusammengeschoben. Durch Brandungswellen und Eisschub kommt es zu Freispühlung und Umlagerung. Die Lebensräume am Meeresgrund befinden sich in steter Veränderung. Der Salzgehalt an der Außenküste von Jasmund liegt bei etwa 1 %; das Wasser ist brackig. So leben hier verschiedene Meeres- und Süßwasserlebewesen in ungewöhnlicher Weise nebeneinander. Moore Moore sind Feuchtgebiete die eine torfbildende Vegetation auf ihrer Oberfläche tragen. Darunter speichern die, aus unvollständig zersetzten Pflanzenresten bestehenden Torfe große Mengen Wasser, aber auch Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen. Den Mooren kommt einerseits eine wichtige Speicherfunktion im Naturhaushalt zu. Andererseits stellen sie einen selten gewordenen Lebensraum für spezialisierte Pflanzen und Tiere dar. Im Nationalpark gibt es zahlreiche Moore, die über das gesamte Gebiet verteilt sind. Es handelt sich vor allem um Quell-, Durchströmungs-, Kessel- und Versumpfungsmoore. Gewässerverlandungs- und Überflutungsmoore sind kleinflächig vertreten. Als Besonderheiten sind schließlich einzelne Regenmoorkalotten auf Durchströmungsmooren und ponorartige "Schlucklöcher" zu erwähnen. Letztere belegen die beginnende Verkarstung der Kreidekalke im Untergrund. Kalktrockenrasen Eine Besonderheit der Kreidelandschaft Jasmunds sind die Kalktrockenrasen. Natürliche Vorkommen dieser Vegetationsform sind die Steilufer der Küste. Abbruchflächen an den Kreidekliffs werden nach einigen Jahren von einer Gesellschaft ganz besonderer Gräser und Kräuter besiedelt. Es sind Pflanzen, die auf sehr spezielle Standortbedingungen angewiesen sind: kalkreicher Boden, trockene Wärme und viel Licht. Der Nichtfachmann ist überrascht von der Formen- und Farbenvielfalt auf diesen Flächen. Auch Orchideen sind hier nicht selten. Aber die Kalktrockenrasen sind nur eine Episode in der Vegetationsentwicklung auf den Steilhängen. Bald wachsen Gehölze empor und beschatten den Boden. Am Ende der Entwicklung steht die Bewaldung der Steilhänge - bis zum nächsten Uferausbruch. Auch im Westen des Nationalparkes, in stillgelegten Kreidebrüchen, gibt es Kalktrockenrasen. Dort sind sie Teil der Pflegezone des Nationalparkes, die Ausbreitung von beschattenden Gehölzen wird im Zuge der Biotoppflege unterbunden. Mittel- und Niederwald Vor Erfindung der Motorsäge war der Holzeinschlag mühsam. Um sich die Brennholzgewinnung zu erleichtern, legte man früher siedlungsnah buschartige Waldungen an, die Niederwälder. Das Prinzip der Niederwaldbewirtschaftung ist einfach: Nach dem Fällen treiben einige Baumarten um die Stubben kranzartig neu aus. Das vorhandene Wurzelwerk führt zu schnellem Wachstum der Triebe. In relativ kurzen Intervallen, bevor die nachgewachsenen Stämme allzu stark sind, kann man reiche Brennholzernte einbringen. Eine andere Form alter Waldbewirtschaftung ist der Mittelwald, eine Kombination aus Nieder- und Hochwald. Hier läßt man einzelne, aus Saat oder Pflanzung hervorgegangene Bäume normal heranwachsen. Diese "Kernwüchse" liefern das Bauholz. Nieder- und Mittelwald sind lichter, auch stärker strukturiert als der Hochwald. Kulturgeschichtliche wie auch naturkundliche Gründe sprechen dafür, einige Mittel- und Niederwälder im Nationalpark zu erhalten. Sie sind Teil der Pflegezone des Nationalparkes. |
Pflanzen Die Kreidelandschaft Jasmunds zeichnet sich durch eine artenreiche Vegetation aus. Im Nationalpark wird das größte zusammenhängende Buchenwaldgebiet an der Ostseeküste geschützt. Nur auf feuchten Standorten vertreten Erlen und Eschen die Buche. Den verschiedenartigen Böden entsprechend ist auch die Krautschicht des Buchenwaldes differenziert. Die bewaldeten Steilhänge und Uferschluchten der Küste sind der Lebensraum von Ahorn und Ulme. Auch seltene Wildobstgehölze und Eiben gedeihen hier. In den Mooren des Nationalparkes sind Wollgräser, Fieberklee, Sonnentau, Riesenschachtelhalm und seltene Moose beheimatet. Nicht weniger interessant sind die Kalktrockenrasen auf den Küstenhängen mit verschiedenen Orchideenarten. Eine weitere Besonderheit ist die Salzvegetation der nördlichen Blockstrände. Salz-Binse, Salzmiere und Strand-Tausendgüldenkraut sind hier zu finden. |
Tiere Artenreich ist die Tierwelt des Nationalparkes. Das Schalenwild ist mit Damhirsch, Rothirsch, Rehwild und Schwarzwild vertreten. Seeadler horsten in der Stubnitz. Bemerkenswert sind auch die an den Kreidekliffs brütenden Mehlschwalben. Zwergschnäpper brüten im Buchenwald. An sonnigen Frühlingstagen nutzen Kraniche die Thermik über dem Wald, um Höhe zu gewinnen, bevor sie über die Ostsee fliegen. In Feuchtgebieten finden sich Ringelnattern und Kreuzottern. Auch die seltene Glattnatter gibt es noch. Häufig ist auf sonnigen Waldwegen die Waldeidechse zu beobachten. Ein gesichertes Vorkommen haben Teich- und Kammolch ebenso wie Rotbauchunke, Erdkröte, Wechselkröte, Teichfrosch, Kleiner Wasserfrosch, Grasfrosch, Moorfrosch und Springfrosch. Als faunistische Raritäten besonders hervorzuheben ist die Alpenplanarie, ein Bewohner kalter Quellen, der als Glazialrelikt gedeutet wird sowie Edelkrebs und Bachforelle. Meerforellen und Lachse suchen im Winter vor der Küste nach Nahrung. |
Naturschutzgeschichte Auf Jasmund reicht die Geschichte des Naturschutzes im weiteren Sinne bis ins 16. Jahrhundert zurück. Ziel war zunächst der rein wirtschaftlich begründete Schutz der Rohstoffquelle Wald. 1586 wurde eine erste Holzordnung erlassen. Sie steht am Anfang jahrhundertelanger Bemühungen um die nachhaltige Waldnutzung auf Ostjasmund. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts drohte die Zerstörung der Steilufer durch den Kreideabbau. Dies rief Naturliebhaber auf den Plan und 1929 wurde das "Naturschutzgebiet Jasmund" per Polizeiverordnung ausgewiesen. Diesem folgte 1986 das "Naturschutzgebiet Quoltitz" im Westteil des heutigen Nationalparkes. Mit der politischen Wende in der DDR drohte dem Gebiet die Gefahr der hemmungslosen touristischen Vermarktung. 1990 - im Zuge des Nationalparkprogramms der DDR - konnte der Nationalpark Jasmund etabliert werden. Damit fand eine Idee ihre Umsetzung, die 1964 von Lebrecht Jeschke erstmals formuliert worden war. |